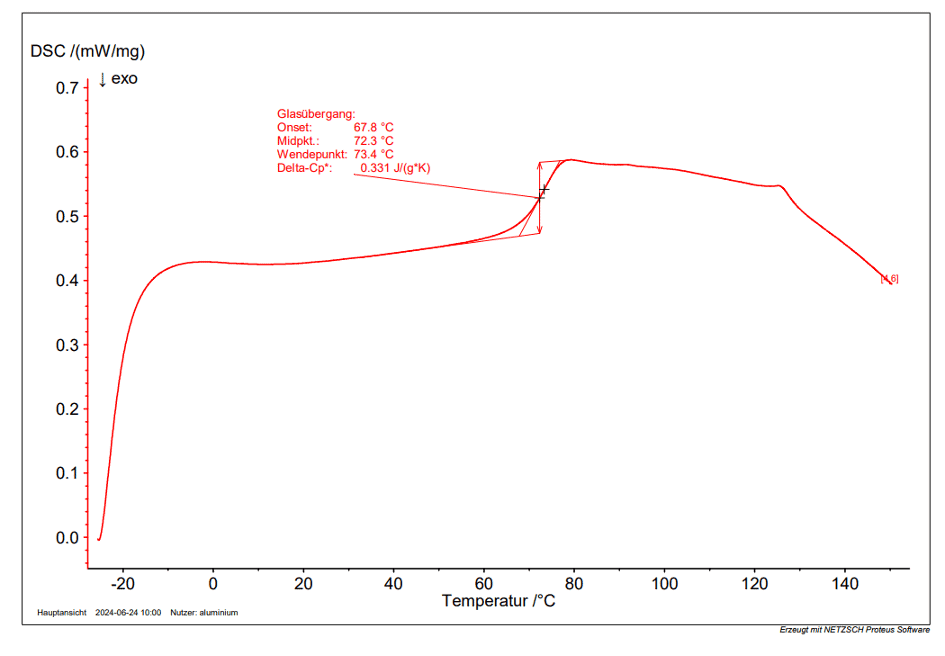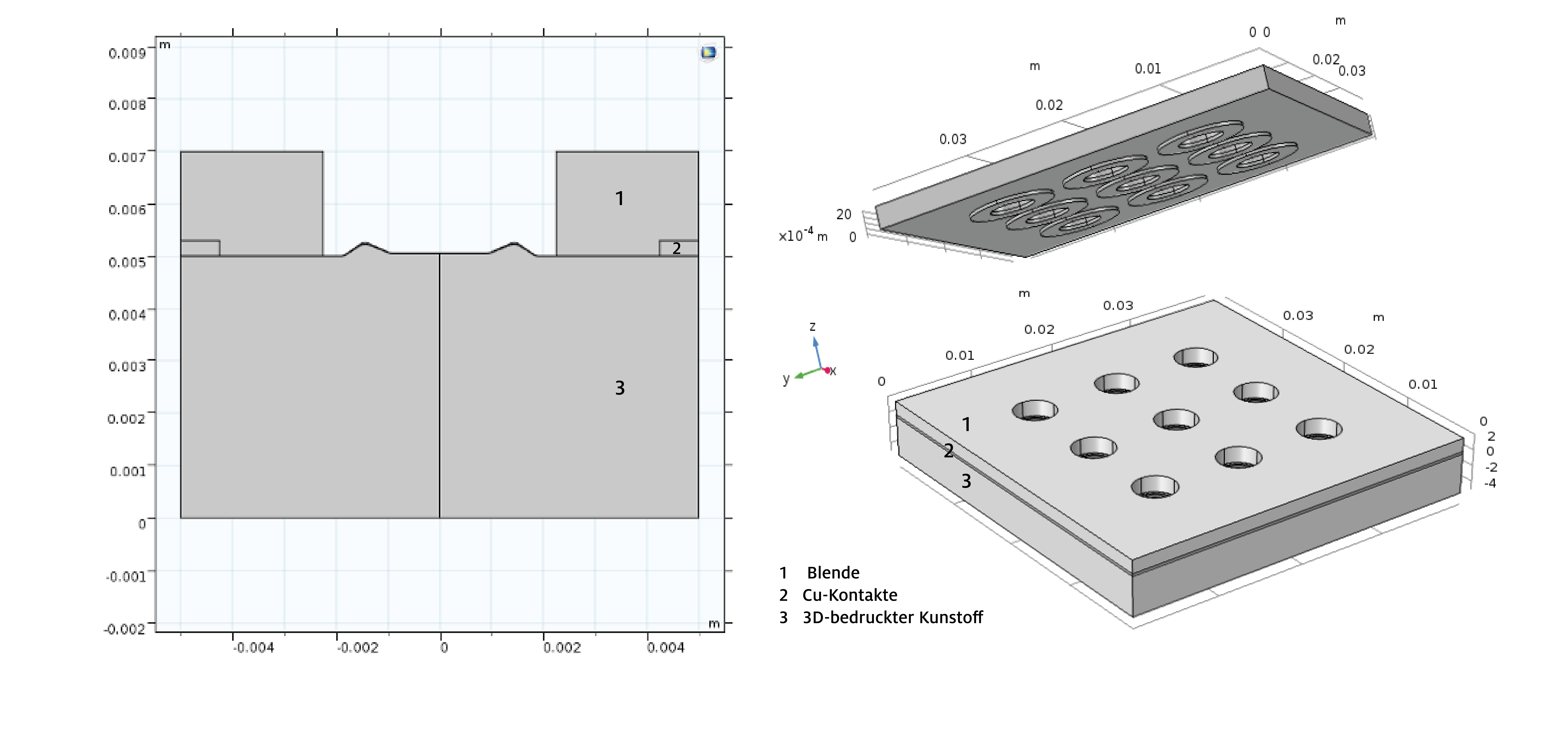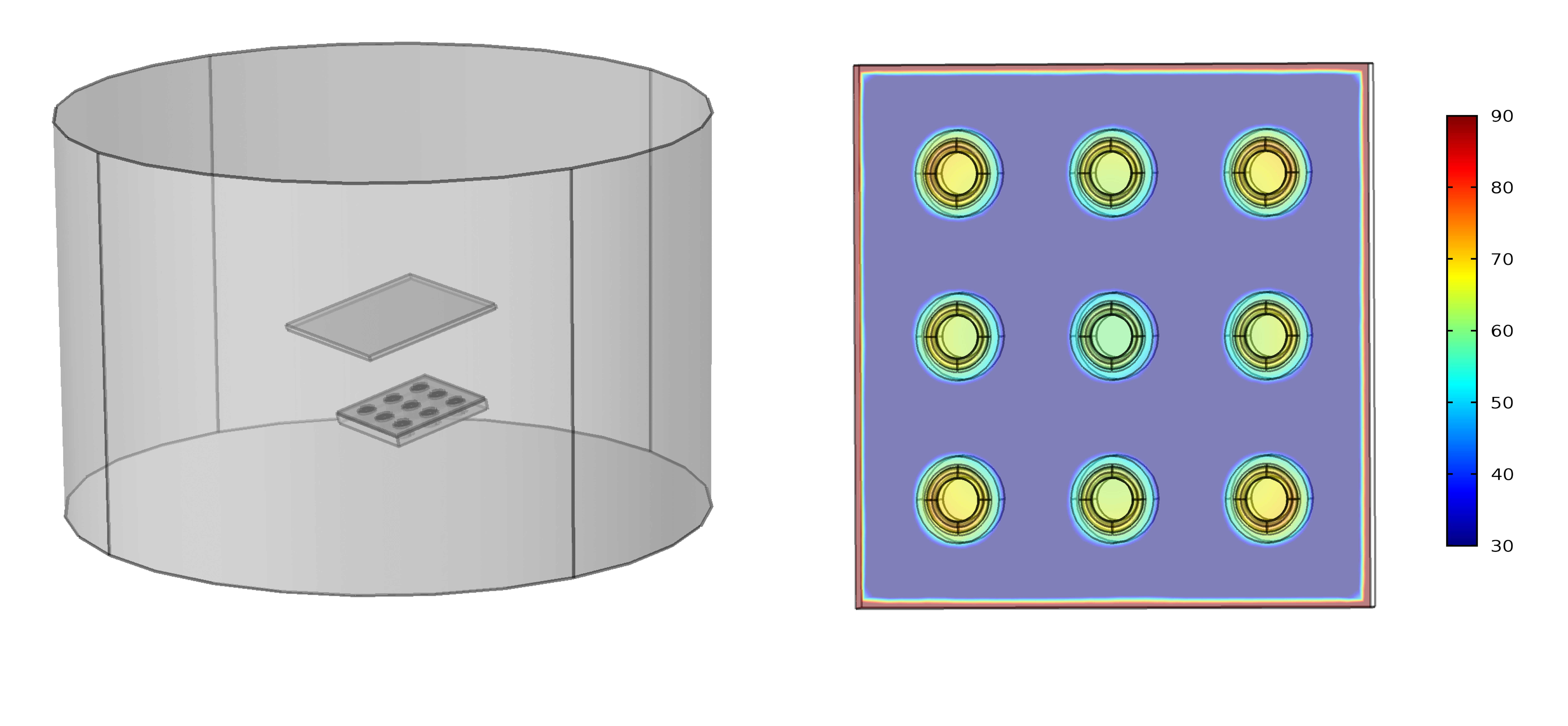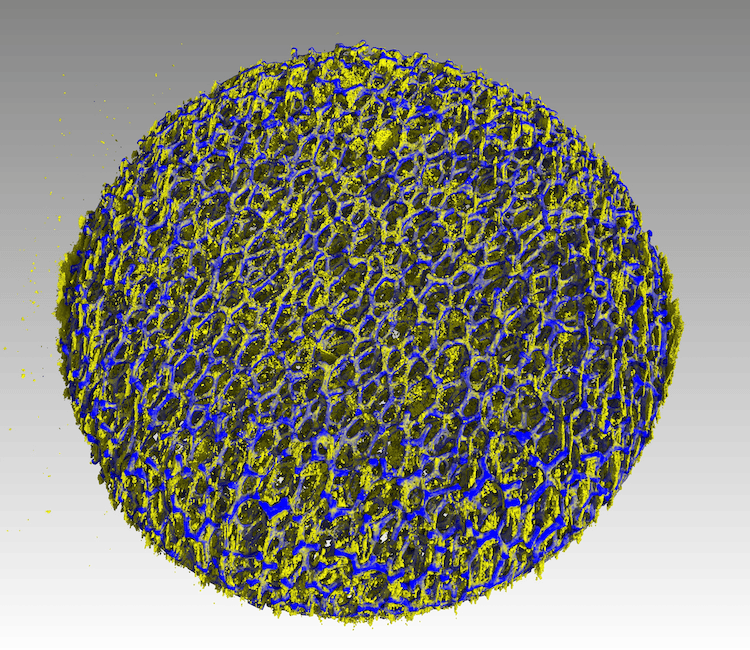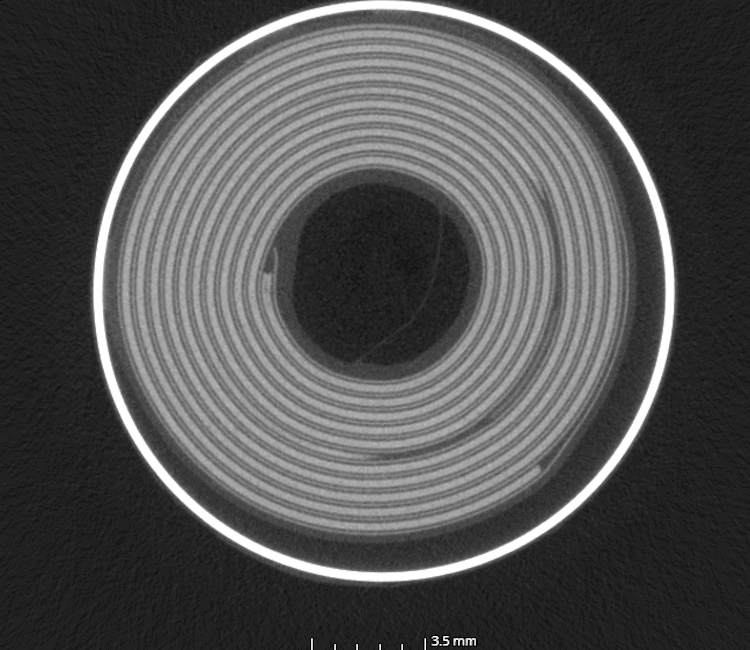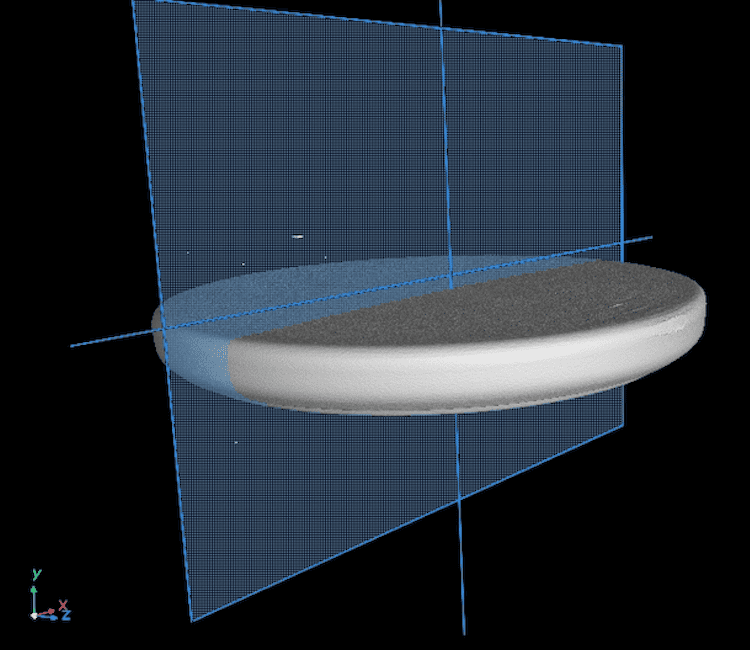Material- und Schichtcharakterisierung
Computertomographie
Defektanalyse, Dimensionelles Messen
Schichtdicke
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), Querschliff, magnetische Verfahren, Wirbelstrom, Calotest, Profilometrie, Coulometrie, STEP-Test
Schichtzusammensetzung
GDOES, Rasterelektronenmikroskopie (REM) mit Elementanalyse (EDX), Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
Struktur und Gefüge
FE-REM, REM, FIB, Kristallstruktur- und Mikrotexturanalyse (EBSD)
Röntgendiffraktometrie (XRD)
Phasenidentifikation, Quantitative Phasenanalyse, Bestimmung der Mikrostruktur (Kristallitgröße), Untersuchung dünner Schichten mit streifendem Einfall, Messung von Eigenspannungen, Bestimmung von Texturen
Röntgenreflektometrie (XRR)
Schichtdicke (5–200 nm), Dichtebestimmung
Rauheit- und Topographiemessung
Taktile Profilometrie, Konfokalmikroskopie, 3D-Digitalmikroskopie
Härte
Mikrohärte, Ultramikrohärte, Buchholzhärte, instrumentierte Eindringprüfung (Eindringhärte, Martenshärte, Nanoindentation), Härteverläufe und Härtekarten, korrelatives Härte- und EDX-Mapping, Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Pendelhärte, Mohs-Härte
Innere Spannungen
Röntgenbeugung, in situ-Bestimmung mit MSM 200
Duktilität
Wölbungstest, Dornbiegeversuch, Zugversuch
Haftfestigkeit
Ritztest, Kugelschlag, Tiefung, Dornbiegeversuch, Temperaturwechselprüfung, Gitterschnittprüfung, Lötmethode und Klebemethode, Rockwell-Eindruck-Test, Haftzugfestigkeit (nach ASTM C 633), Abreißversuch (nach ISO 4624)
Reibung, Verschleiß
Stift-Scheibe-Tribometer, oszillierender Schwingverschleiß, Taber-Abraser, Kratzbeständigkeit, Reinigungsbeständigkeit, Martindale-Prüfung, Abrasive Wheel
Farbe, Glanz, Transmission
Simultanspektrometer, Glanzmessung nach Reimann (Goniophotometer), Transmissionsmessung, Spektralphotometer (45/0, spin, spex), Appearence-Messung (DoI, Orangepeel, etc.), Dreiwinkel-Glanzmessung
Korrosion
Sprühnebel (NSS, AASS, CASS), Kondenswassertests, zyklische Korrosionsprüfung, Filiformkorrosion, komplexe Korrosions-Klimawechselprüfung, CD-Test, elektrochemische Messungen, Künstlicher Schweiß, Nickellässigkeit, Anlauftest
Licht- und Wetterbeständigkeit
Künstliche Bewitterung, Freibewitterung
Lackspezifische Prüfungen
Druckwasserstrahlprüfung, Multisteinschlagprüfung, Chemikalienbeständigkeit, Eindringprüfung
Elektrische Eigenschaften
Elektrische Leitfähigkeit (Sigmascope SMP350), Kontaktwiderstand an Passivierungsschichten / Bipolarplatten / Kontaktwerkstoffen, Bestimmung des Flächenwiderstands (Schichtwiderstand), Durchschlagsbeständigkeit, Scheinleitwert
Thermische Eigenschaften
Temperaturschock, Glasübergangstemperatur, Schmelzpunkt, Klimaprüfung, Alterung, Klimawechselprüfung
Beschichtungsverfahren
Galvanische und chemische Beschichtung
Modellierung und Simulation, Musterbeschichtung, spezielle Verfahren: Legierungsabscheidung, Dispersionsabscheidung, Pulse-Plating, rotierende Elektrode, Galvanoformung
Anodische Oxidation
Vorbehandlungsverfahren, Eloxieren, Tampon-Anodisation, Tauchfärbung, elektrolytische Färbeverfahren, Hartanodisation, Plasma-Anodisation, elektrophoretische Einlagerung, Mehrschicht-Eloxal
PVD / PACVD Verfahren
Magnetron-Sputtern (HIPIMS, MF, DC), Kathodisches Lichtbogenverdampfen, Plasmastrahlbeschichtung (PACVD), Plasma-Immersions-Ionen-Implantation (PIII)
Lacktechnik / Vorbehandlung
Flüssiglackbeschichtung, Pulverlackbeschichtung, strahlenhärtende Lacke (UV/IR), Wirbelsintern
Werkstoffuntersuchungen und Werkstoffentwicklung
Elektronenmikroskopie
FE-REM mit EDX, WDX, FIB, EBSD und STEM-Detektor, TEM-Probenpräparation (Dimpler, Elektrolytisches Polieren, FIB), Ionenpolitur
Metallographische Verfahren
Optische Mikroskopie mit Bildanalyse, Schichtdicke (Querschliff), Phasenanteile, Korngrößenbestimmung, Porenanalyse, Partikeleinbaurate
Technologische Prüfungen
Reibung, Verschleiß, Tiefziehprüfungen
Mechanische Prüfungen
Härte (Vickers, Rockwell, Brinell, Knoop), Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Hochtemperaturprüfung, Spannungsrelaxation
Physikalische Verfahren
3D-Röntgen-Computertomographie, Röntgendiffraktometer, Messung elektrischer/magnetischer Eigenschaften, Benetzungswinkel, thermische Analyse (Differentialthermoanalyse (DTA), Kalorimetrie (DSC), Thermogravimetrie (TG), Dilatometrie)
Metallurgielabor
Legierungsherstellung: Vakuum-Lichtbogenofen, Vakuum-Induktionsofen, Vakuum-Druckgießen, Vakuum-Schleudergießen, Vakuum-Kippgießen; Formgießen: Kokillenguss, Stranggießen, Feingießen; Wärmebehandlung unter Schutzgas und Vakuum; Vakuum-Heißpresse, Walzen, Rundhämmern, Drahtziehen
Additive Fertigung und Pulvermetallurgie
Ultraschall-Plasma-Atomizer, Additive Fertigung mit Prozessüberwachung, Prozessoptimierung, Legierungsentwicklung, Gefüge-Eigenschafts-Korrelation), Vakuum-Heißpresse, Pulverherstellung, Pulvercharakterisierung
Simulation
Phasendiagramme (Thermodynamik, Materialeigenschaften), Diffusionsvorgänge, Prozess-Simulation (Wärmebehandlung, Gießen, additive Fertigung), elektrochemische Abscheideprozesse
Analytik
Materialanalyse, Schadensfälle, Recyclinggüter, Scheidgüter
ICP-OES, ICP-MS, Röntgenfluoreszenz (ED-RFA,
WD-RFA), Kohlenstoff / Schwefel- und Sauerstoff / Stickstoff-Bestimmung, UV-VIS und IR-Spektroskopie, IR-Mikroskopie, Chromatographie (GC, IC), Edelmetallbestimmung (Dokimasie), Summenparameter (TOC, AOX), DSC, Polarisationsmessung, GDOES, Metallanalyse, Legierungsanalyse Spurenbestimmung
Elektrolytcharakterisierung
Cyclovoltammetrie (CV), Cyclic Voltammetric Stripping (CVS), Elektrolytparameter
Zellcharakterisierung
Zyklisierung, Cyclovoltammetrie (CV), Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS), Untersuchung von Einzelzellen und Stacks im Brennstoffzellenteststand und Elektrolyseteststand (U-I-Kennlinien, CV, EIS, Langzeitverhalten)